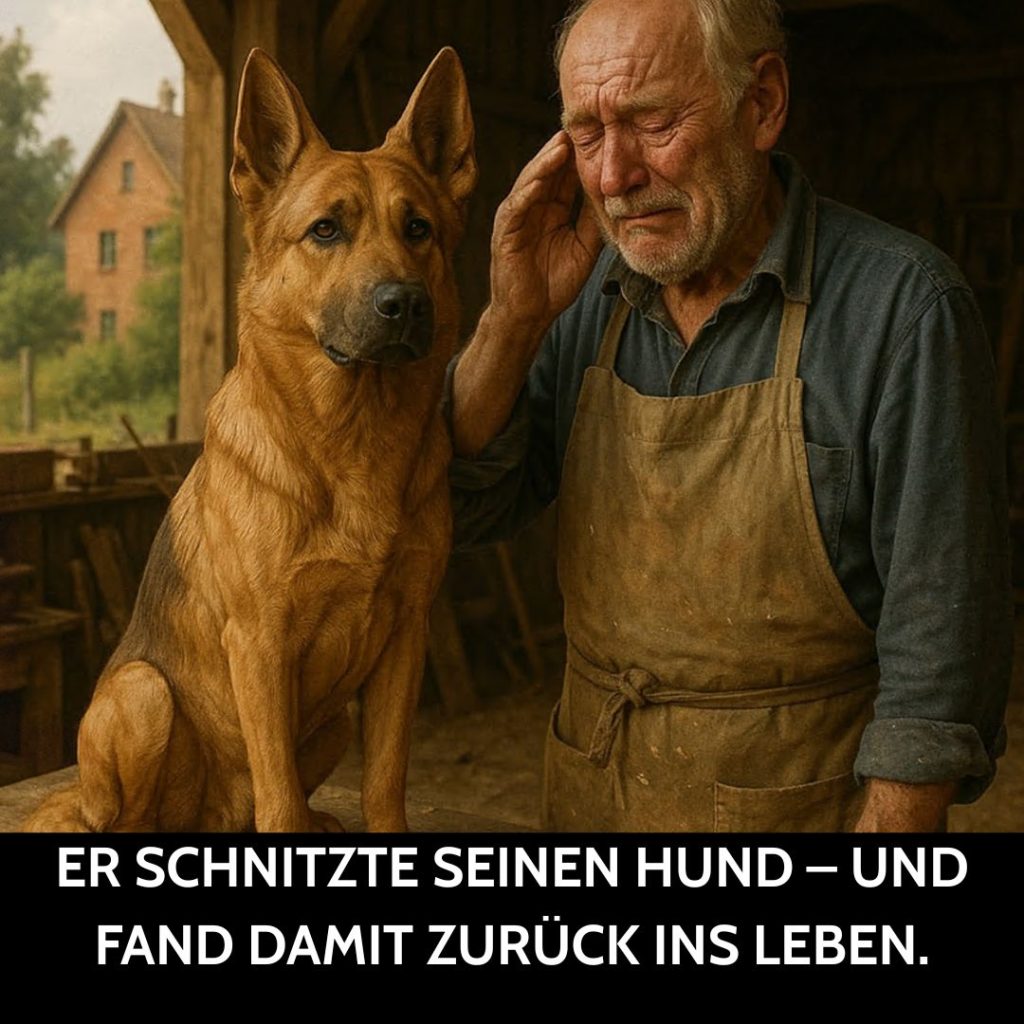„Der stinkt nach Stall, Mama.“
Heinrich Stein hörte die Worte, noch bevor der Wind sie ganz zu ihm trug. Ein Junge, vielleicht sieben oder acht, schob sich hinter dem Gemüsestand seiner Mutter hervor, rümpfte die Nase und zeigte auf Heinrich. Die Mutter zog ihn schnell zurück, murmelte etwas von „nicht so laut“ – aber da war es schon gesagt. Und gehört.
Heinrich stand da, wie jeden Samstag, mit seinen drei Kisten Rotkohl, zwei Kisten Frühkartoffeln und einem Eimer voll Mohrrüben, krumm wie der Rücken, der sie aus der Erde geholt hatte. Kein Preisschild, kein Plastik, keine Schilder mit Bio-Siegeln oder Slogans. Nur die Hände eines 78-jährigen Mannes, die die Erde noch verstanden. Und dreckige Fingernägel, die den Supermarktkunden offenbar nicht ins Bild passten.
Die Frau vor ihm, schick frisiert, mit glänzender Lederhandtasche, griff sich stattdessen zwei eingeschweißte Gurken vom Nachbarstand – Importware aus Spanien – und ging weiter, ohne auch nur den Blick zu heben.
Heinrich sagte nichts.
Er hatte gelernt zu schweigen, wenn man ihn ignorierte.
Vor fünfzig Jahren hätte man ihn noch gefragt, wie die Ernte sei. Damals, als das Dorf kleiner, der Respekt größer und das Wetter noch Gesprächsthema war. Man hätte ihn gekannt. Heinrich Stein vom alten Hof hinterm Bach. Der, der mit 13 schon den Pflug führte wie ein Erwachsener. Der, der nie „Kopfrechnen“ brauchte, weil er mit einem Blick sah, ob ein Acker trug oder nicht.
Damals hatte sein Vater ihn einmal mitten im Winter geweckt, weil das Kalb nicht kommen wollte. Sie standen drei Stunden lang im kalten Stall, dampfender Atem, die Hände tief im Tier. Als es geschafft war und das Kalb wacklig aufstand, hatte der Vater ihm auf die Schulter geklopft und gesagt:
„Du bist ein richtiger Bauer, Hein.“
Kein Lob klang je größer.
Er sah auf die Möhren in seinem Eimer. Die waren nichts für die Instagram-Mütter mit ihren glatten Avocado-Schnitten. Manche davon hatten zwei Enden, manche waren so krumm, dass man lachen musste. Als Kind hatte er solche Möhren immer behalten, ihnen Namen gegeben. Die „Hinkemöhre“, der „Möhrenopa“ – kleine Schätze in einer Welt, in der alles seinen Platz hatte, auch das Unperfekte.
Heute blieb kein einziger Mensch stehen.
Um zwölf Uhr packte er seine Kisten wieder ein. Keine einzige verkauft.
Er lud sie auf die Ladefläche seines alten Opel Blitz. Die Plane war eingerissen, der Lack stumpf – aber der Motor brummte wie ein altes Lied. Heinrich fuhr die vertraute Strecke zurück, vorbei an der alten Mühle, die jetzt ein Yoga-Zentrum war, vorbei am alten Schulhaus, das seit Jahren leer stand.
Dann kam die Kurve. Die Kurve mit dem Feld.
Er fuhr langsamer.
Das Feld war einst das von Franz. Sein bester Freund. Beide 1945 geboren. Beide aufgewachsen mit Händen in der Erde und Wind im Gesicht. Franz war vor drei Jahren gestorben, der Hof verkauft. Jetzt wuchs dort nichts Natürliches mehr. Nur Reihen von Maschinen, ferngesteuert. Keine Menschen, kein Lachen, kein Fluchen über steinige Erde.
Er hielt an.
Stieg aus.
Der Boden war matschig vom Regen der letzten Tage. Traktorreifen hatten tiefe Spuren hinterlassen, aber keine Fußabdrücke. Keine.
Heinrich trat vorsichtig auf den Acker. Er erinnerte sich daran, wie Franz und er hier als Kinder Kartoffeln gelesen hatten – barfuß, mit braunen Beinen, die Sonne im Nacken.
Jetzt stand er allein da. Alt. Vergessen. Beobachtete, wie ein Mähroboter in der Ferne blinkte. Niemand steuerte ihn. Niemand war da, um die Erde zu riechen.
Er sank auf die Knie.
Nicht weil er fiel – sondern weil er es musste.
Weil der Schmerz zu groß war für aufrechtes Stehen.
Weil ihm der Boden vertrauter war als die Welt, in der er lebte.
Seine Hände bohrten sich in den Matsch.
„Franz, wenn du das sehen könntest …“, murmelte er.
Der Wind antwortete nicht.
Ein Auto fuhr vorbei.
Bremste nicht.
Heinrich kniete weiter da, wie ein letzter Zeuge einer verschwundenen Zeit.
Einer Zeit, in der Menschen wussten, wer sie ernährte.
In der ein Bauer noch mehr war als ein alter Mann mit Erde an den Händen.