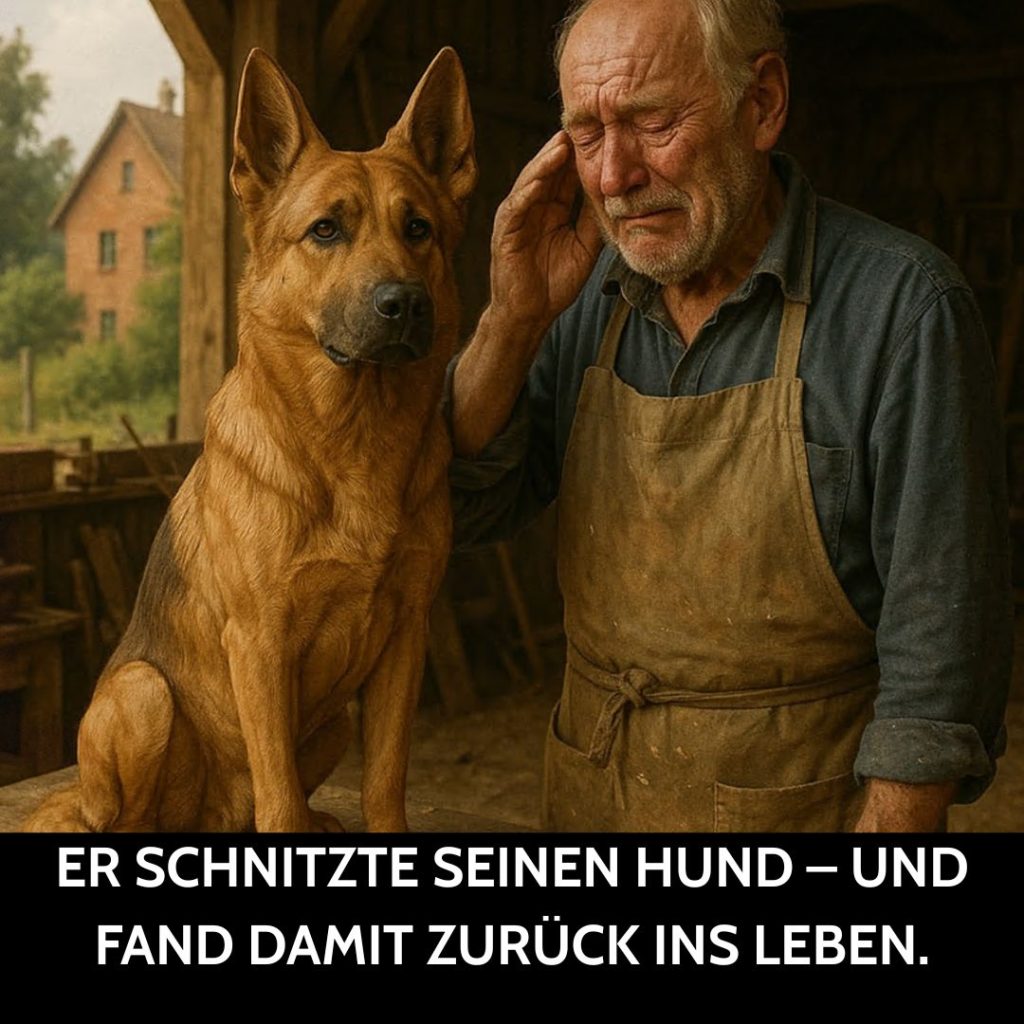An dem Tag, an dem ich die Entlassungspapiere für meine Oma unterschrieb und sie aus dem Pflegeheim in meine 45-Quadratmeter-Wohnung in Berlin holte, stellte der Arzt mir nur eine einzige Frage:
„Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen, Herr Jannik?“
Ich heiße Jannik, bin 27 und arbeite im IT-Support einer mittelgroßen Firma. Gutes Gehalt für mein Alter, keine Studienschulden, geregelter Vertrag auf dem Papier sieht mein Leben ordentlich aus.
Nur dass meine Eltern seit meinem ersten Semester tot sind und meine „Familie“ inzwischen aus exakt zwei Menschen besteht: einer 89-jährigen Frau mit brüchiger Stimme und einem Typen, der tagsüber Serverprobleme löst und nachts Windeln wechselt.
Der Geruch im Pflegeheim klebte an mir, als ich auf Omas Zimmer zuging: Desinfektionsmittel, Kohlrabisuppe, Waschmittel, das nie ganz ausgespült schien. Oma lag halb auf der Seite, der Blick irgendwo zwischen Neonlampe und Fenster.
„Hier ist es so kalt…“, murmelte sie. „Wann gehen wir nach Hause, Jannik?“
„Zuhause“ – das war früher das kleine Haus bei Potsdam mit Apfelbaum im Garten, in dem ich bei ihr und meinen Eltern aufgewachsen bin. Das Haus ist längst verkauft. Übrig geblieben ist meine Mietwohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl, mit kleinem Balkon Richtung S-Bahn-Gleise.
Ich setzte mich auf die Bettkante.
„Oma“, sagte ich, „ich nehme dich mit zu mir.“
Ihre Finger, dünn und leicht wie Zweige, klammerten sich an mein Handgelenk. In ihren Augen lag für einen Sekundenbruchteil so etwas wie Panik oder Hoffnung, ich konnte es nicht unterscheiden.
„Zu dir?“, flüsterte sie. „Aber das ist doch kein Platz für so eine alte Frau.“
„Ist genug Platz für uns beide“, log ich.
Die ersten Tage fühlten sich an wie ein Software-Update, das plötzlich auf Produktion statt auf Testsystem läuft: Man weiß theoretisch, was passieren könnte, hofft aber nur, dass nichts abstürzt.
Morgens richtete ich Oma im Bett auf, zog sie langsam in den Sitz, achtete darauf, dass ihr Kreislauf nicht verrückt spielte. Dann stellte ich den Laptop am Küchentisch auf, loggte mich ins Firmennetz, während Oma im Wohnzimmer leise den Fernseher rauschen ließ.
„Jannik? Ein bisschen Wasser bitte…“
Ich entschuldigte mich im Call, schaltete schnell das Mikro stumm, rannte rüber. Oma saß im Sessel, das Glas schief in der Hand, ein nasser Fleck auf der Decke.
Ich spürte, wie Ungeduld in mir hochstieg, nicht gegen sie, sondern gegen die absurde Situation, in der ich gleichzeitig Tickets bearbeiten und dafür sorgen sollte, dass meine Oma nicht vom Stuhl rutscht.
Nachts ließ ich das Handy mit voller Lautstärke auf dem Nachttisch liegen. Das kleinste Geräusch aus dem Wohnzimmer ließ mich hochfahren. Einmal, gegen halb drei, saß Oma plötzlich aufrecht im Bett, die Augen weit geöffnet.
„Ich muss zur Frühschicht“, flüsterte sie. „Der Meister wird schimpfen, wenn ich zu spät komme.“
„Oma“, sagte ich leise, setzte mich neben sie, „es gibt keine Frühschicht mehr. Du hast dein ganzes Leben gearbeitet. Du darfst jetzt liegen bleiben.“
Manchmal hatte sie klarere Tage. Dann erzählte sie mir von Bombennächten, von Brotmarken, davon, wie sie meinem Vater heimlich ein Stück Zucker aufhob. Sie lachte dabei – dieses leise, kratzige Lachen, das ich aus meiner Kindheit kenne.
„Früher hatten wir nichts und haben trotzdem geteilt“, sagte sie. „Ihr habt jetzt alles und teilt die Einsamkeit.“
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte.
Die Rechnungen stapelten sich. Strom, Heizung, Zuzahlungen für Medikamente. Meine Kollegen fragten immer öfter, ob ich nicht wieder öfter ins Büro kommen könne, „wegen der Teamdynamik“. Ich schob Ausreden vor, verkürzte Pausen, arbeitete länger.
Eines Abends saß ich zwischen Formularen der Pflegekasse, Paragraphen über Pflegegrad, Ansprüche und Leistungen. Ich arbeite mit Code, mit klaren Strukturen. Aber diese Sätze in Amtsdeutsch wirkten wie ein Programm, das absichtlich so geschrieben wurde, dass es niemand versteht.
In diesem Moment verstand ich, warum so viele Familien ihre Alten in Heime geben. Nicht, weil sie sie weniger lieben. Sondern weil diese Verantwortung, verteilt auf zwei müde Schultern, zu schwer werden kann.
Ich griff zum Handy, wählte die Nummer des Pflegeheims. Eine Pflegerin nahm ab. Ich erkundigte mich nach freien Plätzen, stellte abstrakte Fragen, als ginge es um irgendjemand.
„Machen Sie sich keinen Kopf“, sagte sie zum Abschied. „Sie dürfen auch an sich denken.“
Ich legte auf und fühlte mich, als hätte ich etwas Verräterisches getan, obwohl ich nur gefragt hatte.
Der Zusammenbruch kam an einem Samstagabend. Oma bekam plötzlich keine Luft, hielt sich an meinem Pullover fest, die Augen voller Angst. Meine Hände zitterten, als ich die Notrufnummer wählte und auf Deutsch erklärte, was los war.
Im Krankenwagen klammerte sie sich an meine Finger.
„Lass mich nicht allein“, flüsterte sie.
„Ich fahr mit“, sagte ich automatisch.
Im Krankenhaus wurde sie stabilisiert, dann auf ein Zimmer geschoben. Ich durfte nur kurz bleiben. Als ich später in meine Wohnung zurückkam, war sie still auf eine Art, die mir fremd war. Kein leises Räuspern aus dem Wohnzimmer, kein Klappern ihres Wasserglases.
Ich schlief in dieser Nacht fast acht Stunden am Stück.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem Schock: Dieses Ausschlafen hatte sich gut angefühlt.
Der Arzt rief an, meinte, sie dürfe bald wieder heim, „vorausgesetzt, jemand ist da“. Auf dem Weg zurück, die Treppen hinauf in den vierten Stock, blieb Oma plötzlich stehen, stützte sich ans Geländer.
„Jannik“, sagte sie leise, „ist es wegen mir, dass du nicht frei bist?“
Ich schluckte.
„Wie meinst du das?“
„Ich war auch mal so alt wie du. Ich wollte tanzen gehen und bin zu Hause geblieben, weil dein Urgroßvater Pflege brauchte.“ Sie lächelte schief. „Damals war ich wütend auf ihn. Heute erinnere ich mich nur noch daran, wie wir zusammen im Radio Musik gehört haben. Nicht an die Tänze, die ich verpasst habe.“
Sie sah mich an, klarer als sonst.
„Wenn der Arzt irgendwann sagt, dass es besser ist, wenn ich wieder ins Heim gehe, dann mach das. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Ich habe nur Angst, dass du nach der Arbeit in eine leere Wohnung kommst und niemand fragt: ‚War dein Tag schwer?‘“
Dieser Satz traf mich härter als jede moralische Predigt.
Ich begriff, dass es ihr nicht darum ging, wo sie stirbt, sondern wie wir bis dahin miteinander umgehen.
In dieser Nacht schrieb ich zum ersten Mal in eine Nachbarschaftsgruppe:
„Ich bin 27, arbeite im IT-Support und pflege meine 89-jährige Oma bei mir zuhause. Ich brauche kein Geld, aber vielleicht Tipps, wie man das schafft, ohne selbst kaputtzugehen.“
Ich erwartete Schweigen.
Stattdessen blinkte mein Handy. Eine nach der anderen kamen Nachrichten: kleine Hinweise, Erfahrungen, virtuelle Umarmungen. Am nächsten Tag hing eine Tüte Brötchen an meiner Tür, mit einem Zettel: „Für Sie und Ihre Oma. Sie sind nicht allein.“
Oma blieb noch neun Monate bei mir. Es gab gute Tage und furchtbare, Tage voller Lachen und Tage voller Atemnot. An einem kühlen Oktobermorgen fand ich sie friedlich im Bett. Die Hände gefaltet, der Mund in einem leisen Lächeln.
Auf dem Küchentisch lag noch ihr angefangener Briefzettel an mich. Nur ein Satz, in krakeliger Schrift:
„Vergiss nicht, auch dich zu fragen: ‚Bist du heute müde, Jannik?‘“
Seitdem ertappe ich mich dabei, wie ich ältere Menschen im Treppenhaus, an der Bushaltestelle, auf der Parkbank anders ansehe. Manchmal trage ich nur eine Einkaufstüte hoch, manchmal frage ich einfach:
„War Ihr Tag heute schwer?“
Nicht jeder kann seine Oma nach Hause holen. Nicht jeder muss es. Aber von meiner 89-jährigen Oma habe ich gelernt, was in diesem Land, zwischen Termindruck, Plänen und Versicherungsnummern, am meisten fehlt:
Jemand, der uns ehrlich fragt, ob wir noch können.
Manchmal reicht genau das, damit sich niemand mehr ganz so still und unsichtbar alt fühlt.
Weiter zu 🐾 Teil 2 ⏬⏬