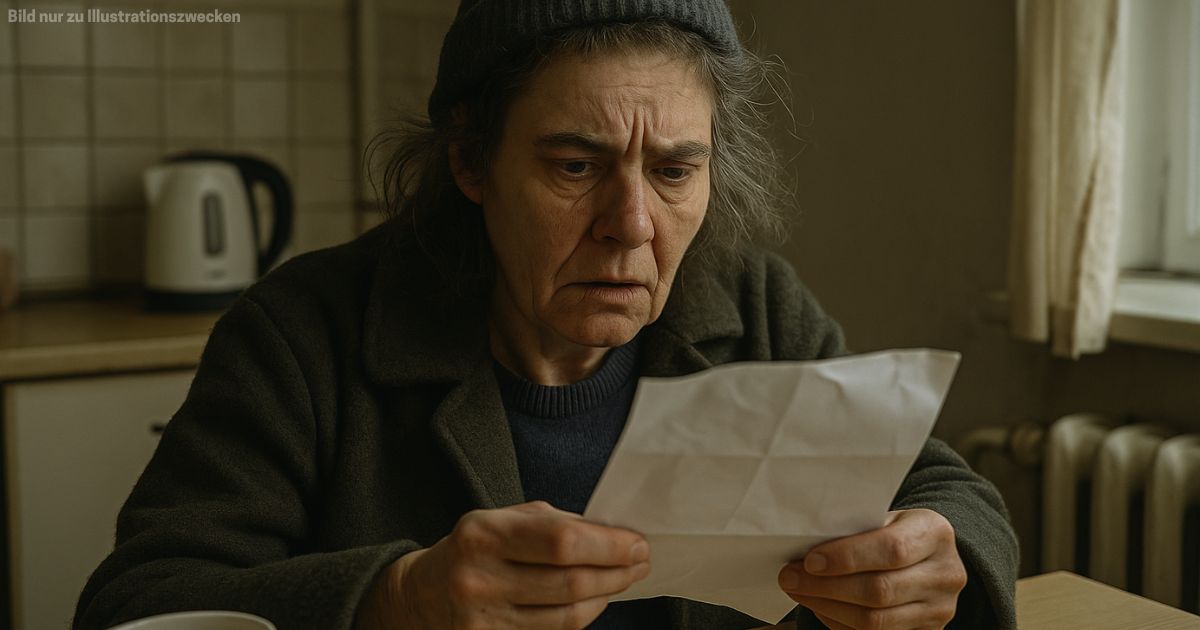Um 7.12 Uhr, der Uhrzeit, in der mein Sohn starb, tippe ich jeden Morgen dieselbe Nachricht an eine Nummer, von der ich weiß, dass sie längst einem Fremden gehört.
„Hast du gefrühstückt, Luca?“
Ich sitze am Küchentisch meiner kleinen Wohnung, irgendwo zwischen Supermarkt und Straßenbahnhaltestelle, und starre auf das Display. Der Wasserkocher klickt, die Heizung gluckert, draußen fährt die erste Bahn vorbei. Die Stadt erwacht, nur in mir bleibt alles stehen.
Seit einem Jahr ist es so.
Seit dem Morgen, an dem ein Arzt mir in einem nüchternen Flur erklärte, dass mein Sohn es „leider nicht geschafft“ hat.
Ich heiße Karin. Früher war ich Erzieherin. Jetzt bin ich vor allem: die Frau aus dem dritten Stock, die allein wohnt und deren Briefkasten nie ganz leer ist, weil die Werbung sich stapelt. Die Nachbarn nicken freundlich im Treppenhaus, halten aber die Hand schon am Geländer, bereit, weiterzugehen.
Ich weiß, dass die Nummer nicht mehr Luca gehört. Nach seinem Tod habe ich den Vertrag gekündigt. Irgendwann hat ein anderer Mensch sie bekommen. Trotzdem schreibe ich.
Jeden Morgen um 7.12 Uhr.
Als würde ich damit die Zeit festnageln können.
Ich drücke auf „Senden“.
Es ist immer derselbe Stich in der Brust, wenn der blaue Haken erscheint.
Heute nehme ich mir vor, nicht ständig aufs Handy zu schauen. Ich ziehe meinen dicken Mantel an, schiebe die Wollmütze über die grauen Haare und gehe zur Bahn. Die Luft ist kalt und klar, die Menschen schweigen, jeder in seine eigene kleine Welt aus Kopfhörern und Gedanken eingesperrt.
Die Bahn ist voll, aber seltsam leise. Eine Frau liest, ein junger Mann scrollt durch Nachrichten, eine Schülerin starrt aus dem Fenster. Ich halte mich an der Stange fest und denke an Luca.
Er wäre jetzt einunddreißig.
Er hat nie gemocht, wenn ich mir im Stehen keinen Sitzplatz suche. „Mama, du bist keine zwanzig mehr“, hat er immer gesagt und gelacht. Sein Lachen hatte diese hellen Falten in den Augen, die mir jetzt in jeder Menge fremder Gesichter fehlen.
Er ist an einem Dienstag gestorben. Auf dem Weg zur Arbeit, ganz früh. Ein Unfall auf einer Kreuzung, mehr musste ich damals gar nicht wissen. Das wichtigste Wort war „sofort“. So schnell, dass man nichts mehr tun kann. So schnell, dass selbst die Erinnerungen nicht hinterherkommen.
Nach der Beerdigung bin ich nach Hause zurückgekehrt, in dieselbe Wohnung, aber in ein anderes Leben. Seine Jacke hing noch im Flur. Seine Schuhe standen neben meinen. In seinem Zimmer lag ein zerknüllter Zettel auf dem Schreibtisch, eine Einkaufsliste. Milch. Brot. Kaffee. Nudeln.
Ich konnte sie wochenlang nicht wegwerfen.
Einmal habe ich abends sein Handy eingeschaltet.
Die letzten Nachrichten:
„Ich bin gleich da, Mama.“
„Mach dir keine Sorgen, ich zieh die Jacke an.“
Sein Profilbild, sein Lachen, als hätte jemand die Zeit angehalten und nur mich weitergeschoben.
Als ich den Vertrag kündigte, fühlte es sich an, als würde ich ihn ein zweites Mal verlieren. Also habe ich die Nummer in meinem Handy behalten.
Und angefangen, ihr weiter zu schreiben.
Die Bahn quietscht. Ich steige aus, kaufe Brötchen beim Bäcker an der Ecke und gehe nach Hause. Die Plastiktüte knistert in meiner Hand. Als ich die Haustür aufschließe, vibriert mein Handy.
Ich bleibe wie festgefroren im Treppenhaus stehen.
Eine neue Nachricht.
Von Luca’ Nummer.
„Ich glaube, Sie schreiben an die falsche Nummer. Aber Ihre Nachricht hat mich berührt.“
Mein Herz fängt an zu rasen. Mehrere Sekunden lang kann ich den Text gar nicht richtig lesen, die Buchstaben verschwimmen. Ich setze mich auf die Stufe, die Brötchen neben mir, und halte das Handy mit beiden Händen.
Ich könnte nicht antworten, denke ich. So tun, als wäre nichts gewesen. Die Nummer löschen, so wie man einen alten Termin löscht. Es wäre vernünftig.
Aber Vernunft hat mich in diesem Jahr nur eins gelehrt: Sie tröstet nicht.
Also tippe ich langsam:
„Nein, ich habe die Nummer nicht aus Versehen gewählt. Sie gehörte früher meinem Sohn. Er ist letztes Jahr gestorben. Ich weiß, dass Sie jemand anderes sind. Ich wollte nur… einmal am Tag so tun, als wäre er noch da.“
Ich starre auf die Worte. Dann drücke ich auf „Senden“ und fühle mich, als hätte ich einen Fremden in mein Wohnzimmer eingeladen.
Die Antwort kommt schneller, als ich erwarte.
„Es tut mir sehr leid um Ihren Sohn. Ich kenne Sie nicht, aber… ich habe auch jemanden verloren. Vielleicht tut es gut, ein bisschen zu schreiben. Wenn Sie möchten.“
Ich lese den Satz dreimal.
Da ist kein Spott, keine Ungeduld. Nur diese vorsichtige Offenheit, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe.
Die nächsten Tage schreiben wir hin und her.
Ich erfahre, dass die andere Person Jonas heißt. Dass er einige Straßen weiter wohnt, in einem kleinen Zimmer mit Blick auf die Gleise. Dass er seine Mutter vor zwei Jahren an eine Krankheit verloren hat und seitdem das Gefühl hat, Bahnhofshallen seien die ehrlichsten Orte der Welt, weil dort niemand so tut, als wäre er nicht auf dem Sprung.
Ich erzähle ihm von Luca. Dass er viel zu viel Kaffee getrunken hat und dass er immer zu schnell gelaufen ist, als müsste er ankommen, bevor seine eigenen Gedanken ihn einholen. Dass er mir jeden Sonntag Brötchen gebracht hat und nie ohne Umarmung die Wohnung verlassen durfte.
Wir schreiben über Nächte, in denen man nicht schlafen kann, weil das Bett auf einmal doppelt so groß ist. Über Supermarktgänge, in denen man an den Lieblingsjoghurt des anderen vorbeikommt und fast anfängt zu weinen. Über die seltsame Stille in Hausfluren, in denen früher Stimmen klangen.
Eines Abends schreibt Jonas:
„Möchten Sie sich vielleicht einmal auf einen Kaffee treffen? Nur, wenn es sich richtig anfühlt. Kein Druck.“
Ich starre lange auf die Frage.
Darf man jemandem, dessen Nummer einmal dem eigenen Kind gehörte, im echten Leben begegnen?
Ist das nicht ein Verrat?
In der Nacht wälze ich mich im Bett hin und her. Ich höre Luca’ Stimme in meinem Kopf, dieses halb genervte, halb liebevolle: „Mama, du kannst nicht für immer allein bleiben.“
Am nächsten Morgen schreibe ich:
„Ja, gerne. Im kleinen Café neben der Straßenbahnhaltestelle.“
Die Tage bis zum Treffen ziehen sich und verfliegen zugleich. Als ich das Café betrete, riecht es nach Kaffee und nassen Mänteln. Menschen tippen auf Laptops, eine alte Frau liest Zeitung. Niemand schaut mich an. Ich bin nur eine weitere Gestalt in einem grauen Mantel.
Ich setze mich an einen Tisch am Fenster, halte die Tasse so fest, dass meine Finger weiß werden. Als die Tür klingelt, sehe ich ihn: Jonas. Jünger, als ich gedacht hätte, mit müden Augen und einem zu großen Schal.
Er setzt sich mir gegenüber, lächelt unsicher.
Für einen Moment sagen wir beide nichts.
Dann flüstere ich:
„Ich habe Angst, dass mein Sohn ganz verschwindet, wenn ich aufhöre, an seine Nummer zu schreiben.“
Jonas schaut auf seine Hände, dann zu mir.
„Ich habe meine Mutter fast verloren, als ich aufgehört habe, von ihr zu erzählen“, sagt er leise. „Vielleicht ist Schreiben an eine Nummer ein Anfang. Aber vielleicht… ist der nächste Schritt, dass wir uns gegenseitig von ihnen erzählen. Damit sie in mehr als einem Herzen weiterleben.“
Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich nicke, weil ich nicht sprechen kann.
An diesem Nachmittag erzähle ich einem fremden Menschen Dinge, die ich noch nie jemandem gesagt habe. Wie Luca als Kind Angst vor Gewitter hatte. Wie er sein erstes Gehalt fast komplett für einen viel zu teuren Blumenstrauß für mich ausgegeben hat. Jonas erzählt von seiner Mutter, die jedes Jahr viel zu viele Plätzchen gebacken hat und heimlich Nachbarn damit versorgt hat, die keinen Besuch bekamen.
Wo zwei Lücken im Leben nebeneinander sitzen, entsteht langsam etwas, das kein Ersatz ist, aber auch keine Leere mehr.
Ein paar Wochen später stehe ich mit Jonas an einem kleinen Fluss, der durch unsere Stadt fließt. Es ist kalt, wir tragen Handschuhe. Jeder von uns hält eine Kerze in der Hand. Wir stellen sie nebeneinander auf einen Stein am Ufer.
„Für Luca“, sage ich.
„Für meine Mutter“, sagt Jonas.
Die Kerzenflammen zittern im Wind, aber sie gehen nicht aus.
Ich schreibe meinem Sohn immer noch manchmal. Aber nicht mehr jeden Morgen um 7.12 Uhr. An manchen Tagen schreibe ich stattdessen Jonas. Oder ich gehe in den Seniorenkreis im Gemeindehaus und höre anderen Menschen zu, die jemanden verloren haben.
Ich habe gelernt:
In diesem Land, in dem Türen leise schließen und Nachbarn höflich, aber zurückhaltend sind, kann schon eine einzige Antwort auf eine „falsche Nummer“ genug sein, damit zwei Menschen ein Stück Trauer gemeinsam tragen.
Trauer verschwindet nicht, wenn man sie teilt.
Aber sie wird leichter, wenn eine andere Hand ein kleines Stück davon mit festhält.
Weiter zu 🐾 Teil 2 ⏬⏬