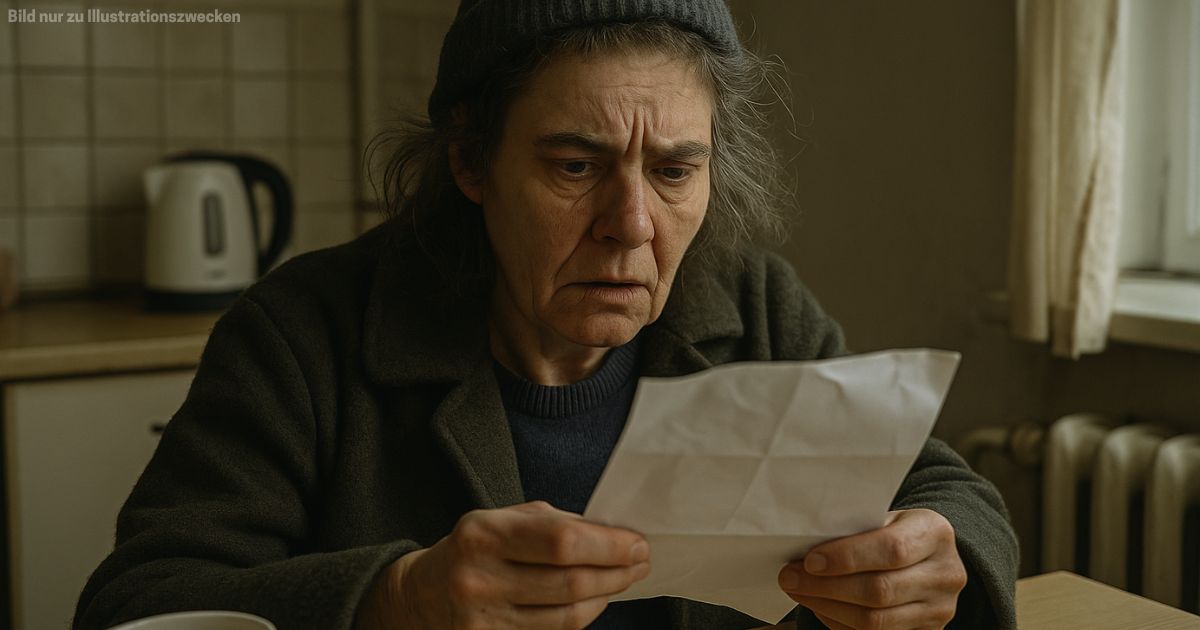Ich spüre einen Stich, aber diesmal ist er anders.
Keine Panik, mehr ein klarer Schmerz, der sagt: Du wusstest, dass dieser Moment kommt.
„Ich werde wieder allein sein“, sage ich leise.
„Nein“, widerspricht Jonas. „Sie kennen jetzt Menschen im Seniorenkreis. Mich. Und sich selbst ein bisschen anders. Sie wissen, dass Sie schreiben können. Reden. Dass Sie antworten können, wenn jemand sich meldet.“
Er schaut auf das Wasser, das träge vorbeifließt.
„Vielleicht ist das die eigentliche Nummer, die zählt“, sagt er. „Nicht die im Telefon. Sondern wie oft man wählt, überhaupt in Kontakt zu gehen.“
Ein paar Wochen später kommt die endgültige Nachricht vom Anbieter:
Die Umstellung ist erfolgt.
Jonas schreibt mir keine SMS mehr von „Luca’ Nummer“. Er ruft an. Oder wir sehen uns einfach. Wenn sein Umzug tatsächlich klappt, wird es seltener werden, aber nicht unmöglich.
Am ersten Morgen nach der Umstellung wache ich um 7.06 Uhr auf, wie immer, bleibe aber liegen.
Der alte Reflex drängt mich zum Handy.
Ich schaue auf das Display zum ersten Mal ohne die vertraute Zahlenfolge oben.
Die Stille ist ohrenbetäubend.
Ich stehe auf, koche Wasser, setze mich an den Küchentisch.
Um 7.12 Uhr schlage ich das blaue Notizbuch auf, nehme meinen Stift in die Hand.
„Guten Morgen, Luca“, schreibe ich. „Heute schreibe ich dir aus einem Leben, in dem du fehlst, aber nicht mehr alles bist, was existiert. Ich habe Angst, dass du das falsch verstehst. Aber ein junger Mann, der mal deine Nummer hatte, hat mir gezeigt, dass Liebe nicht kleiner wird, wenn man Platz für anderes macht.“
Ich halte inne.
Draußen fährt eine Bahn vorüber.
Ich höre ihr nach und merke, dass mein Herz zwar wehtut, aber nicht mehr nur brennt. Es schlägt auch.
„Wenn du sehen könntest, wie ich heute Kaffee trinke und dabei mit Menschen lache, die deine Lieblingsbrötchen mögen würden“, schreibe ich, „dann würdest du mich vermutlich tadeln und gleichzeitig stolz grinsen.“
Meine Hand zittert, als ich den letzten Satz des Tages setze:
„Ich habe dich nicht losgelassen, Luca. Ich habe nur aufgehört, mich an einer Nummer festzuklammern. Der Rest – du, deine Stimme, dein Lachen – bleibt. In mir. Und in den Geschichten, die wir jetzt über dich erzählen.“
Als ich das Notizbuch schließe, merke ich, dass ich tief einatme.
Nicht vorsichtig, sondern so, als dürfte die Luft in meinen Lungen ruhig ein bisschen Platz haben.
Vielleicht ist das der Moment, in dem Trauer nicht weniger wird, aber sich endlich traut, neben dem Leben zu sitzen.
Nicht als Feind.
Sondern als etwas, das mich daran erinnert, wie sehr ich geliebt habe und noch immer lieben kann.