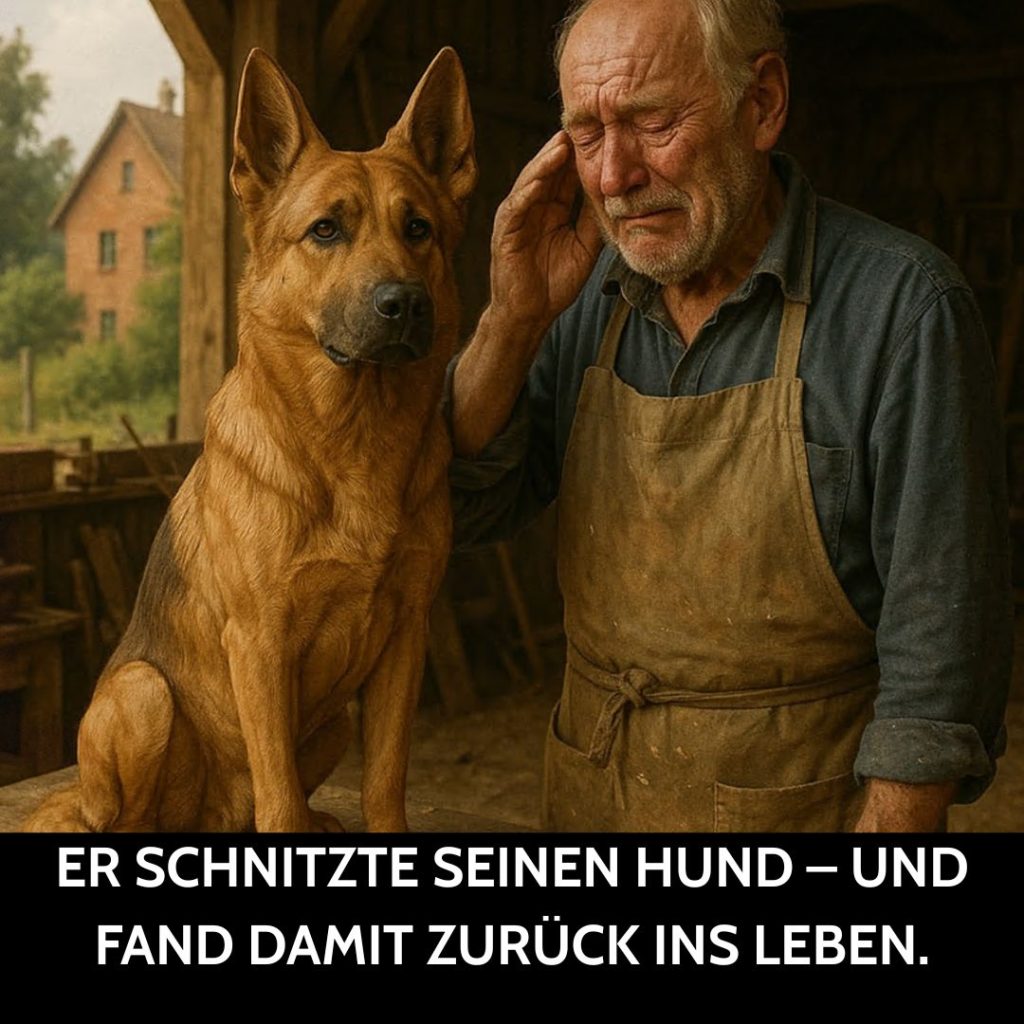Dies ist der zweite Teil der Geschichte: was nach der dritten Kündigung geschah, als ein Nebenjob mich rettete.
Am Anfang nannte ich es noch „Aushilfe“. Das klang kleiner, ungefährlicher, als müsste ich mich vor niemandem rechtfertigen, nicht einmal vor mir selbst. Drei Nachmittage die Woche Stühle rücken, Tee ausschenken, Namen lernen, die ich mir auf kleine Zettel schrieb und in die Westentasche steckte.
Im Begegnungszentrum hing ein laminiertes Blatt an der Wand: „Wir freuen uns über Ihr Engagement, Thomas.“
Ich stand oft davor, als müsste ich mich selbst daran erinnern, dass jemand sich offiziell über meine Anwesenheit freute. Im Lager hatte nie ein Zettel mit meinem Namen an der Wand gehangen, höchstens eine Schichtliste.
Nach zwei Wochen bekam ich Post von der Arbeitsagentur.
Ein Termin, „Beratungsgespräch“. Schon das Wort ließ meinen Magen zusammenziehen. Ich trug den Brief in der Jackentasche, während ich im Zentrum Tassen spülte, und jedes Rascheln klang wie eine Erinnerung daran, dass ich auf dem Papier noch immer „arbeitssuchend“ war.
Beim Termin saß mir ein junger Mann gegenüber, vielleicht so alt wie Nathalie, ordentliches Hemd, Tablet vor sich.
„Also, Herr Keller“, sagte er und tippte. „Sie arbeiten jetzt ehrenamtlich im Begegnungszentrum?“
„Mit kleiner Aufwandsentschädigung“, sagte ich. „Ein paar Stunden die Woche.“
Er nickte, ohne aufzusehen.
„Das ist schön, gesellschaftliches Engagement ist wichtig“, sagte er im Tonfall eines Lehrbuchs. „Aber für Ihren Lebenslauf sollten wir etwas Langfristiges im ersten Arbeitsmarkt anvisieren.“
Er sprach von „Maßnahmen“ und „Profiling“, von „Vermittlungschancen“ und „Zielvereinbarungen“. Ich hörte wieder nur ein Wort: „Noch nicht genug.“ Das hatte zwar keiner gesagt, aber es stand zwischen uns wie eine unsichtbare Überschrift.
Als ich später im Zentrum ankam, stand Frau Schneider schon im Flur, in ihrem Mantel, der an den Schultern etwas ausbeulte.
„Da sind Sie ja“, sagte sie erleichtert. „Ich dachte schon, heute fällt der Kaffeenachmittag aus.“
Niemand fragte nach meinem Lebenslauf. Niemand wollte wissen, ob die Stunden „anrechenbar“ waren. Jemand brauchte einfach, dass ich die Tassen auf Tabletts stellte und rechtzeitig Milch nachfüllte.
Mit der Zeit lernte ich die Stammgäste kennen.
Da war Frau Lenz, die jedes Mal behauptete, es gebe „heute ausnahmsweise“ nur ein kleines Stück Kuchen, um sich dann doch nachnehmen zu lassen. Und Herr Yilmaz, der immer zu früh kam und half, die Stühle zu stellen, weil „sitzen und zugucken“ noch nie sein Ding gewesen sei.
Und dann war da Herr Brandt.
Er setzte sich immer an den Rand, nie in die Mitte, und hielt seine Hände so auf dem Tisch, als müsste er sie festhalten, damit sie nicht zitterten. Auf seinem Namensschild stand „Karl Brandt“. Ich fragte ihn, ob ich ihn Karl nennen dürfe.
„Wenn Sie unbedingt müssen“, grummelte er. „Aber ich höre sowieso nicht mehr so gut.“
In der dritten Woche blieben wir nach dem offiziellen Programm noch zu zweit in der Ecke sitzen.
„Sie sind nicht von hier“, stellte er fest.
„Nordrhein-Westfalen ist groß“, antwortete ich. „Aber ich bin auf der richtigen Seite des Rheins, wurde mir gesagt.“
Er zog den Mund leicht nach oben.
„Ich war vierzig Jahre unter Tage“, sagte er. „Dann war Schluss. ‚Strukturwandel‘ nannten sie das. Ich nannte es einen Tritt in den Rücken.“
Ich erzählte ihm nichts von meinen Kündigungen. Noch nicht. Aber in dem Moment verstand ich, dass wir etwas gemeinsam hatten: dieses Gefühl, dass jemand anders über den Wert unserer Arbeit entschieden hatte, ohne uns zu fragen, was es mit uns machte.
Eine Woche später blieb ein Stuhl leer.
Herr Brandt war nicht da. Sein Kaffeeplatz stand gedeckt, niemand hatte ihn abgemeldet. Ich schaute ständig zur Tür, jedes Mal mit dem Reflex, aufzustehen.
Nach dem Nachmittagsprogramm fragte ich die Leiterin, Frau Mertens, ob sie etwas wisse.
„Seine Tochter hat gestern angerufen“, sagte sie. „Er ist im Krankenhaus, nichts Lebensbedrohliches, aber er ist gestürzt. Sie meinte, er wirkt… mutlos.“
Das Wort traf mich. Mutlos. Ich kannte diesen Zustand, in dem man nicht einmal mehr wütend war, sondern nur noch leer.
Am Abend erzählte ich Nathalie davon am Telefon.
„Fahr hin“, sagte sie einfach. „Wenn du dir das zutraust.“
„Ich bin kein Verwandter“, wandte ich ein. „Vielleicht… störe ich.“
„Papa“, sagte sie. „Du bist der, bei dem er jede Woche sitzt, obwohl er ‚nicht gut hört‘. Vielleicht ist genau das kein Zufall.“
Zwei Tage später stand ich mit einem billigen Strauß Chrysanthemen in einem Krankenhausflur. Der Geruch nach Desinfektionsmittel und gekochtem Gemüse mischte sich zu diesem typischen Null-Gefühl, das jeder Klinikflur hat. Ich fühlte mich fehl am Platz in meiner abgetragenen Jacke.
„Besuch für Herrn Brandt?“, fragte eine Schwester.
„Ein… Bekannter aus dem Begegnungszentrum“, murmelte ich.
Als ich das Zimmer betrat, lag er halb aufgerichtet, der Fernseher lief stumm, irgendeine Talkshow. Er drehte den Kopf langsam zu mir.
„Na, wen haben wir denn da“, murmelte er. „Ich dachte schon, ich komme hier ohne Kaffee davon.“
Ich stellte die Blumen ab, setzte mich auf den Stuhl.
„Die Kaffeemaschine vermisst Sie“, sagte ich. „Und Frau Lenz behauptet, der Kuchen schmeckt schlechter, wenn Sie nicht meckern.“
Ein Schatten eines Lächelns huschte über sein Gesicht. Dann wurde er ernst.
„Man hat mir gesagt, ich soll mich schonen“, sagte er. „Aber wozu? Damit ich noch ein paar Jahre länger niemandem fehle?“
Der Satz saß. Ich schwieg einen Moment, weil mir die Antwort so vertraut vorkam, dass sie hätte von mir sein können.
„Im Zentrum fehlen Sie“, sagte ich. „Die Läster-Runde über den trockenen Kuchen ist ohne Sie nur halb so professionell.“
Er schnaubte.
„Das meinen Sie nicht ernst.“
„Doch“, sagte ich. „Und außerdem… wenn Sie nicht da sind, muss ich Ihre Sprüche übernehmen. Und ich bin darin sehr schlecht.“
Er sah mich lange an, so als würde er überprüfen, ob ich mir das, was ich sagte, nicht nur aus Höflichkeit ausgedacht hatte.
„Ich habe gedacht“, murmelte er schließlich, „nach der Schließung der Zeche war ich fertig. Nur noch Füllmaterial. Jetzt liege ich hier und denke: Selbst im Begegnungszentrum kann man mich ersetzen.“
„Man kann Ihren Stuhl besetzen“, sagte ich leise. „Aber nicht Ihre Art, ihn zu benutzen.“
Es war ein unbeholfener Satz, aber er zuckte mit den Mundwinkeln.
„Sie reden komische Sachen, Thomas“, sagte er. „Aber kommen Sie ruhig nächste Woche wieder. Sonst vergesse ich noch ganz, wie man meckert.“
Auf dem Heimweg überlegte ich, wie oft ich selbst mich schon für „Füllmaterial“ gehalten hatte. Vielleicht war es das, was Frau Schneider gemeint hatte, als sie von der Entscheidung sprach, trotzdem Mensch zu bleiben.
Ein paar Tage später sprach mich Frau Mertens nach dem Kaffeekränzchen an.
„Herr Keller, hätten Sie nächste Woche Zeit, unsere neue Montagsrunde zu übernehmen?“, fragte sie. „Es geht nur um eine Stunde. Thema: ‚Arbeit, die bleibt‘.“
Ich starrte sie an.
„Ich soll… moderieren?“, fragte ich.
„Sie haben ein Händchen dafür, die Leute zum Reden zu bringen“, sagte sie. „Und Sie kennen beide Seiten: Job, kein Job.“
Zuhause saß ich lange vor einem leeren Blatt Papier. „Arbeit, die bleibt“ – ich wusste selbst noch nicht genau, was das bedeutete. Nathalie kam am Wochenende vorbei, setzte sich an meine Seite.
„Schreib auf, was du dir früher unter Arbeit vorgestellt hast“, sagte sie. „Und daneben, was heute bei dir bleibt, wenn der Lohnschein weg ist.“
Wir machten zwei Spalten. In der einen stand „Schichtplan“, „Überstunden“, „Weihnachtsgeld“, „Staplerschein“. In der anderen „Frau Schneider lacht, wenn die Kartoffeln heil oben ankommen“, „Herr Brandt schimpft, aber kommt trotzdem“, „Nathalie traut mir die Wahrheit zu“.
Zum ersten Mal sah ich schwarz auf weiß, dass in der zweiten Spalte nichts stand, was man mir kündigen konnte.
Die Montagsrunde verlief holprig und ehrlich.
„Wer von Ihnen hat schon mal eine Kündigung bekommen?“, fragte ich in die Runde.
Zuerst war es still. Dann hob eine Frau zögernd die Hand, dann ein Mann, dann noch einer. Am Ende waren es fast alle.
Sie erzählten von Betrieben, die verschwunden waren, von neuen Chefs, von „Umstrukturierungen“. Manche lachten bitter, manche wurden plötzlich ganz leise.
„Und was ist geblieben?“, fragte ich.
Es kamen seltsame Antworten.
„Mein Talent, alles kaputt zu kriegen, was ich anfasse“, brummte einer. Die Runde lachte.
Doch dann sagte eine Frau:
„Ich kann immer noch stricken. Und plötzlich sind meine Enkelinnen stolz, dass sie Mützen tragen, die niemand sonst hat.“
„Ich kann zuhören“, sagte ein anderer nach langem Überlegen. „Früher am Band, wenn einer Ärger hatte. Heute meiner Nachbarin, seit ihr Mann im Heim ist.“
Weiter zu 🐾 Teil 3 ⏬⏬