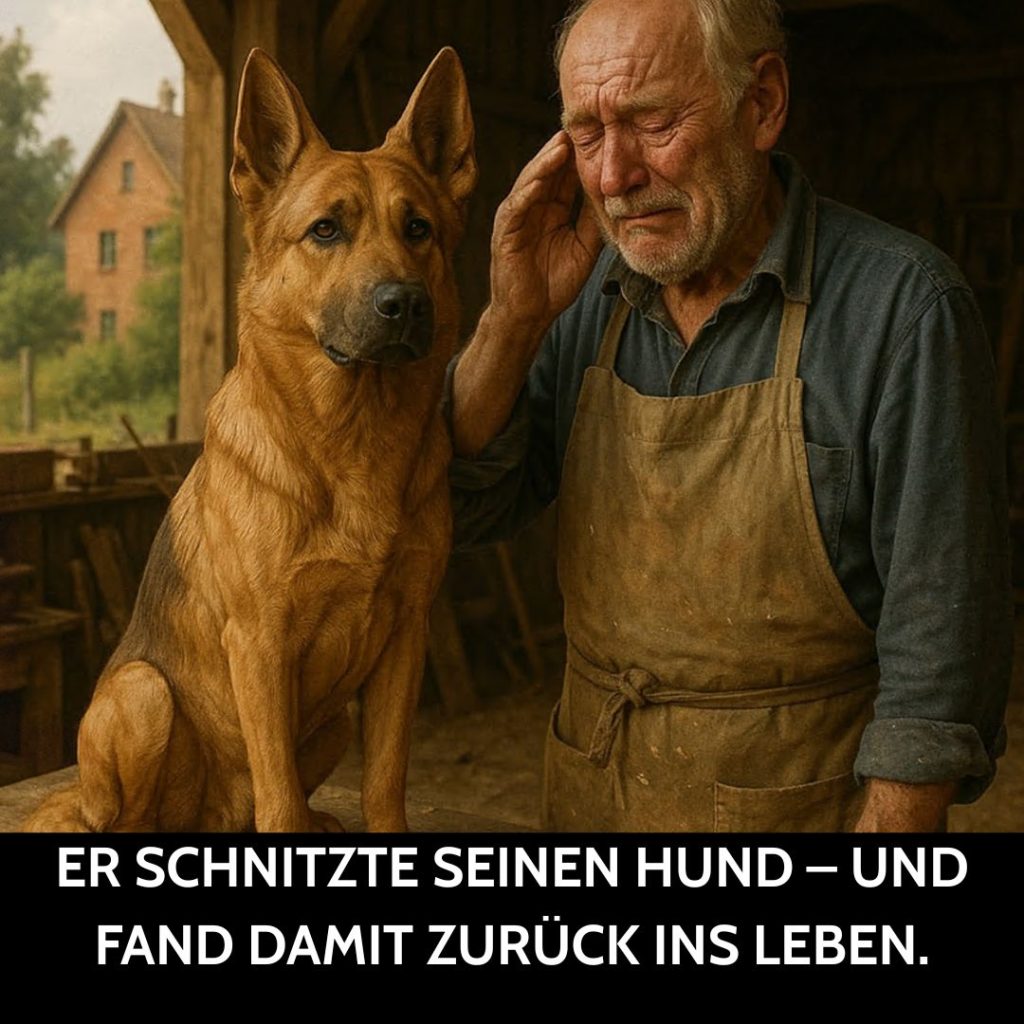Falls du dich fragst, was aus mir wurde, nachdem ich im Auto saß und „Ich kündige“ gesagt hatte, genau davon möchte ich dir jetzt erzählen.
Ich weiß nicht, wie lange ich damals im Auto saß.
Die Scheiben beschlagen, der Schlüssel im Zündschloss, meine Hände im Schoß gefaltet wie bei einer Patientin, die auf eine Diagnose wartet.
Ich hätte einfach losfahren können. Stattdessen starrte ich auf den Eingang des Klinikums, als wäre es ein Mensch, von dem ich mich trennen musste.
Es war seltsam still.
Kein Alarm, kein Klingeln, kein Ruf nach „Schwester!“
Nur das Ticken der Uhr auf dem Armaturenbrett und mein eigener Atem.
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten war da keine Liste im Kopf, kein „Als Nächstes muss ich…“.
Nur eine riesige, beängstigende Leere.
Zu Hause roch es nach abgestandenem Kaffee und Waschmittel.
Mein Mann, Paul, saß am Küchentisch, die Zeitung vor sich, die Lesebrille in der Hand statt auf der Nase.
Er hatte auf mich gewartet, obwohl er meinen Schichtplan kannte.
Als ich die Tür schloss, sah er sofort, dass diesmal etwas anders war.
„Maggi?“
Nur mein Name, leise.
Ich legte meine Tasche auf den Boden, das Stethoskop noch darin, Schlüsselbund obenauf.
„Ich habe gekündigt“, sagte ich.
Keine dramatische Geste, keine Tränen. Nur ein Satz, der zwischen uns hinfiel wie ein Glas, das in Zeitlupe zu Boden geht.
Paul sagte nichts.
Er stand auf, langsam, als wäre er plötzlich älter geworden, und legte mir die Hände auf die Schultern.
Wir standen da, mitten in der Küche, zwischen Wäschekorb und Brotkasten, wie zwei Menschen, die einen Verlust betrauern, den sie noch gar nicht ganz begreifen.
„Wurde es zu viel?“, fragte er schließlich.
„Es wurde zu wenig“, antwortete ich.
Zu wenig Menschlichkeit, zu wenig Zeit, zu wenig Respekt.
Zu viel von allem anderen.
Die ersten Tage danach waren merkwürdig.
Ich wachte trotzdem um fünf Uhr morgens auf, hörte in der Ferne Sirenen und mein Körper spannte sich an, als müsste ich jeden Moment springen.
Dann fiel mir ein, dass niemand auf mich wartete.
Kein Dienstplan, kein Stationszimmer, kein Mann mit Smartphone, der mich „nur eine Pflegekraft“ nannte.
Ich versuchte, „normal“ zu sein.
Ich kaufte frische Brötchen, sortierte alte Unterlagen, goss unsere Zimmerpflanzen so gründlich, als wären sie Intensivpatienten.
Aber mein Kopf blieb im Klinikum.
Ich sah beim Einkaufen fremde Gesichter und dachte automatisch: „Sieht blass aus. Vielleicht Anämie?“
Man hört nach 42 Jahren nicht einfach auf, Pflegekraft zu sein.
Eines Abends bekam ich eine Nachricht von Lena.
Lena ist 26, eine junge Kollegin, die vor drei Jahren zu uns kam, mit Tattoos unter dem Kasack und Augen, die alles gleichzeitig aufnahmen.
Sie hatte mich seit ihrem ersten Praxiseinsatz „Mentorin“ genannt, obwohl ich ihr nie etwas Förmliches beigebracht habe.
Ich habe ihr nur gezeigt, wie man einer sterbenden Frau die Stirn streichelt, ohne sie zu bevormunden.
„Maggi, darf ich dich mal anrufen?“, stand da.
Wir telefonierten eine Stunde.
Lena weinte nicht, aber ihre Stimme war brüchig.
„Wir sind heute wieder mit drei Leuten weniger in die Spätschicht.
Die Stationsleitung sagt, es sei halt so.
Die Patienten beschweren sich, der Druck steigt, und neulich hat mir einer ins Gesicht gesagt, ich sei faul, weil ich seine Extra-Decke nicht sofort gebracht habe.“
Ich hörte zu und spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog.
Nicht Schuld, sondern eine alte, vertraute Wut.
Die Wut darüber, dass Menschen, die geben, bis sie leer sind, am Ende noch den Vorwurf hören, sie seien nicht genug.
„Willst du auch kündigen?“, fragte ich sie.
Es wurde kurz still.
Dann sagte sie: „Ich weiß es nicht. Ich liebe die Patienten. Aber ich hasse das System. Wie du.
Ich frage mich nur: Wenn Leute wie du gehen, was bleibt dann für uns?“
Ihre Frage traf mich tiefer als jede Bemerkung über „nur eine Pflegekraft“.
Ich hatte das Gefühl, das Klinikum zu verlassen wie ein sinkendes Schiff.
Aber was ist mit denen, die noch nicht schwimmen gelernt haben?
Nach diesem Gespräch lag ich lange wach.
Ich drehte mein altes Namensschild zwischen den Fingern, bis der Kunststoff sich warm anfühlte.
Ich war gegangen, um mich selbst zu schützen.
Aber konnte ich wirklich einfach die Tür hinter mir schließen?
Am nächsten Morgen beschloss ich etwas, das sich fast nach einem neuen Dienstplan anfühlte.
Kein offizieller, nur meiner.
Ich setzte mich an den Küchentisch, schnappte mir Papier und Stift und schrieb.
Nicht eine Kündigung, nicht eine Beschwerde.
Einen Brief.
„An alle, die glauben, dass Pflegekräfte ‚nur‘ etwas tun“, schrieb ich in die Überschrift.
Ich erzählte von Herrn Kowski, von der alten Dame um drei Uhr morgens, von den Tablets in der Pandemie und von dem Mann mit dem Smartphone.
Ich erklärte, was es bedeutet, die Hand eines Sterbenden zu halten.
Wie sich der Raum verändert, wenn jemand das letzte Mal ausatmet.
Wie man danach trotzdem weiterarbeitet, weil das Leben im Zimmer nebenan weitergeht.
Ich schrieb über die jungen Kolleginnen und Kollegen, die rennen, dokumentieren, trösten, während im Hintergrund jemand auf die Uhr schaut.
Ich schrieb, dass Freundlichkeit keine Zusatzleistung ist, sondern ein Minimum.
Nicht nur von uns, sondern auch von denen, die unsere Arbeit in Anspruch nehmen.
Paul las den Brief, als ich fertig war.
Er sagte nichts, bis zum Schluss.
Dann nickte er nur.
„Schick ihn ab“, meinte er. „Egal wohin. Hauptsache, er bleibt nicht in dieser Küche.“
Ich schickte ihn an die Lokalzeitung, an ein Online-Magazin, an eine Bekannte, die in der Kommunalpolitik ist.
Weiter zu 🐾 Teil 3 ⏬⏬